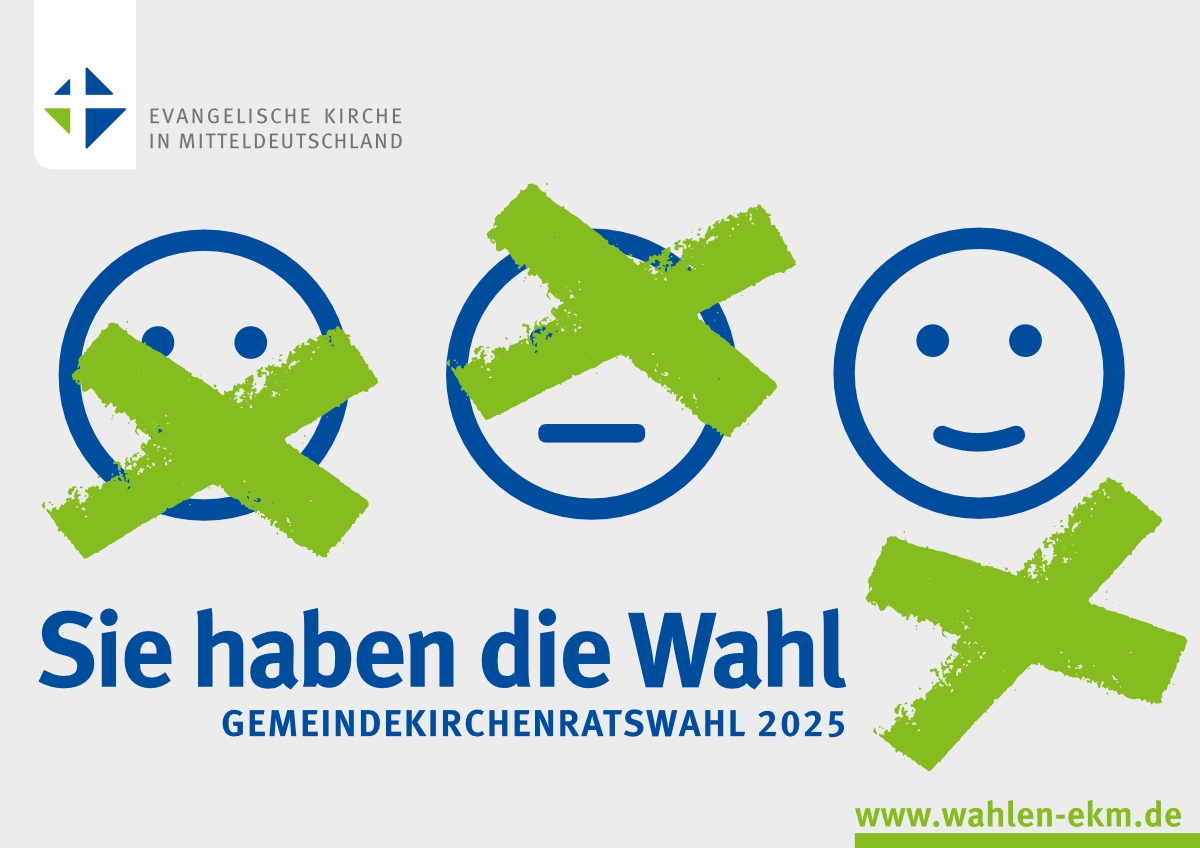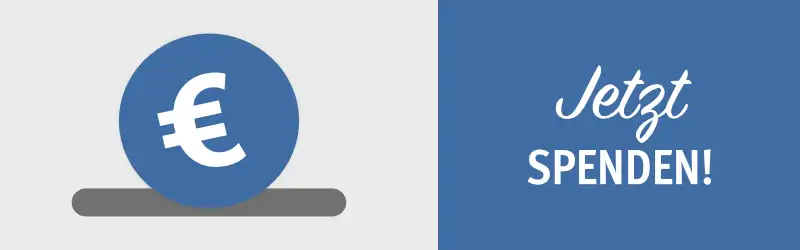31.10.2025
Festgottesdienst 31.10.2025 in Heldburg
DOWNLOAD
- Kanzel Heldburg - (13.08.2025 / 1.008 KB)
Einladung zur Wiedereinweihung der historischen Steinkanzel in Heldburg
Die Reformationskanzel (1536) in der Heldburger Stadtkirche
Die Stadtkirche in Heldburg beherbergt einen besonderen „Schatz“: Ihre Kanzel aus dem Jahre 1536 und der im Folgejahr entstandene Taufstein ermöglichen uns - wie nur wenige andere kirchliche Ausstattungsstücke in Europa - einen Blick in die Frühzeit der Reformation vor 500 Jahren. Mit ihnen können wir in die früheste Phase der Entwicklung evangelischer Kirchenausstattung schauen - als sich die ersten Reformatoren gefragt haben: Wie setzen wir unseren „neuen Glauben“ in Bilder und neue kirchliche Ausstattungsstücke um?
Diese Frage stellte sich sicherlich auch Friedrich Schwalbe, der 1528, mit Einführung der Reformation in der „Pflege Coburg“, erster Superintendent in Heldburg wurde. Er hatte 1515 bei Martin Luther in Wittenberg studiert und seine Familie war mit Philipp Melanchthon befreundet. Seine Aufgabe war es nun auch, das begonnene Bauprojekt an der Heldburger Kirche fortzusetzen und das Kirchenschiff errichten zu lassen. Ebenso oblag es ihm, die Kirche im Sinne des „neuen Glaubens“ mit Kanzel und Taufstein auszustatten, welche er selbst stiftete.
Diese beiden Prinzipalstücke entstanden im neuen Kunststil der Renaissance, mit neuartigen Bildkonzepten, die den Menschen veranschaulichen sollten, was der neue evangelische Glaube bedeutet.
Alle Heldburger Kanzel-Bilder gehen auf Vorlagen von Lucas Cranach d.Ä. zurück, die er im Wesentlichen in den 1520er Jahren in Wittenberg entwickelt hat, teilweise in Kooperation mit seinem engen Freund Martin Luther. Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte die schnelle Verbreitung neuer evangelischer Bildideen über Druckgrafiken. Friedrich Schwalbe hatte zudem Kontakte zum engsten Kreis der Reformatoren und konnte damit für Kanzel und Taufe ein protestantisches Bildprogramm konzipieren, das damals überaus aktuell war.
Geschaffen hat die beiden Stücke der Bildhauer Bernhard Friedrich aus Halle, der mit seinem Meisterzeichen, Initialen und dem Halleschen Stadtwappen auch auf der Kanzel vertreten ist.Vorlagen Ludwig Reß, 1888, mit Ergänzung wesentlicher nicht mehr erhaltener Inschriften nach Johann Werner Krauss, 1752 (Susanne Pohler)
Bedeutung der Kanzelbilder
Auf den ersten drei Brüstungsplatten sehen wir eine Darstellung von „Gesetz und Evangelium“, dem bekanntesten Lehr-Bild des Protestantismus. Es handelt sich dabei um die Verbildlichung von Luthers zentraler Rechtfertigungslehre, die Rechtfertigung „allein durch den Glauben“. In der Mitte sitzt der Mensch zwischen dem Gesetz des Alten Testamentes (links dargestellt mit Adam und Eva und dem Propheten) und dem Evangelium: Er wird erlöst durch den Opfertod und die Auferstehung Jesu Christi im Neuen Testament zu seiner Rechten. Zentral ist auch Johannes der Täufer erkennbar, der auf diese frohe Botschaft hinweist. Im Sockelbereich der Tafeln wird dieses Bildthema nochmals durch „TODT“ und „GENAD“ (Gnade) symbolisiert.
Auf dem Sockel des Pilasters zwischen Tafel 2 und 3 ist eine Darstellung der Lucretia mit dem Dolch erkennbar - ebenfalls ein Bildmotiv, das Cranach d.Ä. als Symbol für weibliche Stärke und Tugend in die frühe Kunst der Reformation einbringt.
Zukunftsweisend waren auch die Inschriften, welche die Bilder der Heldburger Kanzel kommentierten - nun in deutscher, nicht mehr in lateinischer Sprache.
Auf der 4. Tafel ist der Apostelabschied dargestellt. Dieses Motiv der Apostel, denen Christus den Auftrag gibt „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium“ knüpft auf der einen Seite an die Funktion der Kanzel als Predigtort an. Auf der anderen Seite hat das Motiv auch eine reformationsgeschichtliche Bedeutung: Es werden hier die Apostel mit den ersten Reformatoren verglichen, wie Luther oder auch der Kanzelstifter Friedrich Schwalbe, welche die neue protestantische Lehre verbreiten sollen. Dabei fällt ein Apostel in seiner Gestaltung etwas aus dem Rahmen und er ist auch der Einzige, der ein Buch in der Hand hält und offenbar den beiden anderen die Bibel erläutert. Von der Physiognomie her handelt es sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit um Martin Luther, der auf frühen evangelischen Bildern regelmäßig mit dargestellt ist, wie z.B. auf den Reformationsaltären in Wittenberg und Weimar. Luther war ein überaus wichtiges „Markenzeichen“ zur Verbreitung reformatorischer Gedanken.
Alle diese Bilder der Kanzel sollten also nicht nur den „neuen Glauben“ in Bildern anschaulich machen, sondern auch die protestantische Lehre verbreiten.
Ursprünglicher Aufstellungsort
Schon 2016 hatten wir anhand von Abarbeitungsspuren entdeckt, dass die Kanzel ursprünglich am nordöstlichen Mittelschiffspfeiler aufgestellt war - und dies wurde 2023 durch archäologische Grabungen nochmals bestätigt.
Und auch dieser ursprüngliche Aufstellungsort der Kanzel hat eine wichtige reformatorische Aussage: Die Verkündigung des Wortes Gottes auf der Kanzel -in deutscher Sprache- wird zum Zentrum des evangelischen Gottesdienstes und die Kanzel muss dementsprechend „in die Mitte der Gemeinde“ rücken.
Demontage und Wiedererrichtung der Kanzel
In den Jahren 1819-1826 wurde die Heldburger Kirche neugotisch umgestaltet und man hat damals offenbar diese hochrangige Reformationsausstattung nicht mehr in ihrer Bedeutung erkannt. Sie wurde überwiegend entfernt, teilweise sogar vernichtet. Die Kanzel und die Taufe hatte man damals zerlegt und in Nischen abgestellt. So sind glücklicherweise die vier steinernen Brüstungsteile als Kernstücke der Kanzel sowie das Kapitell der Kanzelsäule erhalten geblieben.
2017 fand zunächst eine restauratorische Voruntersuchung und Notsicherung der Kanzelteile durch den Steinrestaurator Hendrik Romstedt statt. Eines der Ergebnisse war, dass die Kanzel eine farbige Teilfassung hatte, mit sparsamer Betonung bestimmter Details wie Haare, Wappen, Gewandsäume - geringe Reste davon sind noch erkennbar.
Ebenso entwarf Romstedt damals eine schlichte Stahlkonstruktion, welche die erhaltenen Teile zusammenfügt und sie als Kanzel wieder nutzbar macht, mit einer Kanzeltreppe entsprechend ihrem ursprünglichen Verlauf.
Dank Fördermitteln der Bundesministerin für Kultur und Medien, der Kunst- und Kulturgutstiftung der EKM und des Landesdenkmalamtes wird die Konservierung und Restaurierung der erhaltenen Kanzelteile sowie die Wiederaufstellung am ursprünglichen Standort in Kürze abgeschlossen sein. Und so können wir am diesjährigen Reformationstag gemeinsam mit dem Landesbischof die Wiedererrichtung dieser ältesten evangelischen Steinkanzel feiern - einem überaus bedeutenden Stück Reformationsgeschichte von europäischem Rang, das den theologischen Aufbruch in die Neuzeit vor 500 Jahren anschaulich macht.
Susanne Pohler
Die Verfasserin dankt Inge Grohmann, ohne deren grundlegende Forschungen und Hinweise viele neue Erkenntnisse der letzten Jahre nicht möglich gewesen wären.
DOWNLOADS
- Kanzel Heldburg - (13.08.2025 / 1.008 KB)